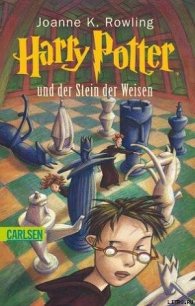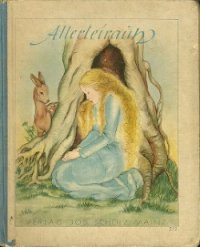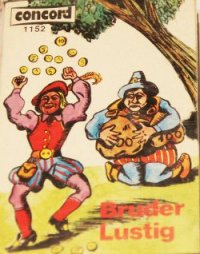Der Schwarm - Schatzing Frank (читать книги TXT) 📗
»Ich wei? nicht.« Sie zuckte die Achseln. »Vielleicht zu Hause?«
»Jack ist nie zu Hause. Ich denke, ihr seid zusammen?«
»Mein Gott, Leon! Wir haben nicht geheiratet, wenn du das meinst. Wir haben Spa? und sind verknallt, aber ich uberwache doch nicht jeden seiner Schritte.«
»Nein«, murmelte Anawak. »Das ware auch nichts fur ihn.«
»Wieso fragst du? Willst du ihn sprechen?«
»Ja.« Er fasste sie bei den Schultern. »Licia, pass auf. Ich muss ein bisschen privaten Kram erledigen. Versuch ihn aufzustobern. Vor heute Abend, wenn’s geht, damit wir Shoemaker nicht das Essen verderben. Sag ihm, ich … ich wurde mich freuen, ihn zu sehen. Ja, ganz ehrlich! Ich wurde mich freuen. Ich hatte regelrecht Sehnsucht nach ihm.«
Delaware lachelte unsicher.
»Gut. Ich werd’s ihm sagen.«
»Fein.«
»Ihr Manner seid komisch. Echt. Du meine Gute. Ihr seid wirklich ein paar komische Affen.«
Anawak ging aufs Schiff, sah die Post durch und schaute auf einen Sprung bei Schooners vorbei, wo er einen Kaffee trank und mit Fischern plauderte. Wahrend seiner Abwesenheit waren zwei Manner in einem Kanu verungluckt und gestorben. Sie hatten sich trotz des strikten Verbots hinausgewagt. Keine zehn Minuten hatte es gedauert, bis sie von Orcas gerammt worden waren. Die Uberreste des einen Mannes waren spater angespult worden, von dem anderen fehlte jede Spur. Niemand verspurte Lust, ihn zu suchen.
»Ist ja nicht deren Problem«, sagte einer der Fischer, womit er die Betreiber der gro?en Fahren, Frachter und Fabriktrawler und die Kriegsmarine meinte. Er trank sein Bier mit der Verbissenheit desjenigen, der den Schuldigen ausgemacht zu haben glaubt und sich durch nichts und niemanden davon abbringen lasst, ihm die Verantwortung fur seine Misere anzulasten. Dann sah er Anawak an, als erwarte er von ihm eine Bestatigung.
Es ist sehr wohl deren Problem, war Anawak versucht zu sagen, ihren Schiffen geht es keinen Deut besser. Er schwieg. Was sollte er antworten? Er durfte uber die gro?en Zusammenhange nicht sprechen, und die Leute in Tofino sahen nur ihren Ausschnitt der Welt. Sie kannten die Statistik uber die Zunahme schwerer Unglucke nicht, mit denen Peak den Stab konfrontiert hatte.
»Nee, Junge, denen kommt das doch gelegen!«, knurrte der Mann. »Die gro?en Fangflotten dehnen ihr Monopol immer weiter aus, und jetzt so was. Sie haben uns die Bestande weggefischt, und jetzt raumen sie den Rest auch noch ab, nachdem wir Kleinen nicht mal mehr rausfahren konnen.« Und dann, nach einem weiteren Zug aus seinem Glas, sagte er: »Wir sollten diese verdammten Wale abschie?en. Wir sollten ihnen zeigen, wo der Hammer hangt.«
Es war uberall dasselbe. Wo immer Anawak hinhorte in den Stunden, seit er in Tofino war, klang die gleiche Forderung durch.
Toten wir die Wale.
War alles umsonst gewesen? Die Jahre der Muhsal, um ein paar lumpige, lochrige Schutzverordnungen zu erzwingen? Auf seine Weise hatte der frustrierte Fischer am Tresen von Schooners den Nagel auf den Kopf getroffen. Aus Sicht der kleinen Fischer brachte die Situation den Gro?en nur Vorteile ein, weil gro?e Fabrikschiffe die Fanggrunde als Einzige noch befahren konnten und jene, denen die Erlasse der Internationalen Walfangkommission, eingeschrankte Fangquoten und Jagdverbote immer schon ein Dorn im Auge gewesen waren, endlich eine Legitimation vorweisen konnten, wieder Wale zu jagen.
Anawak bezahlte seinen Kaffee und ging zuruck zur Station. Der Verkaufsraum war leer. Er machte es sich hinter der Theke bequem, schaltete den Computer ein und begann, das World Wide Web zu durchforsten auf der Suche nach militarischen Dressurprogrammen. Es war muhsam. Diverse Seiten lie?en sich nicht aufrufen. Wahrend sie im Chateau Zugriff auf jede gewunschte Information hatten, krankte das offentliche Netz zunehmend unter dem Ausfall der Tiefseekabel.
Anawak lie? sich nicht entmutigen. Die offizielle Homepage des US Navy’s Marine Mammal Program zur militarischen Arbeit mit Meeressaugern fand er schnell. Was dort zu lesen war, kannte er bereits aus dem Whistler Circuit. Jeder bessere investigative Journalist hatte dutzendfach daruber berichtet. Er schloss die Seite und suchte weiter. Nach kurzer Zeit stie? er auf Meldungen uber ein militarisches Programm in der ehemaligen Sowjetunion, die viel versprechend klangen. Eine gro?ere Anzahl Delphine, Seelowen und Belugas waren demnach wahrend des Kalten Krieges mit dem Auffinden von Minen und verloren gegangenen Torpedos betraut und zum Schutz der Schwarzmeerflotte eingesetzt worden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren die Tiere in ein Ozeanarium in Sevastopol auf der Krimhalbinsel uberfuhrt worden und hatten dort Zirkuskunststucke vorgefuhrt, bis den Betreibern das Geld fur Lebensmittel und Medikamente ausgegangen war und sie vor der Alternative standen, ihre Schutzlinge entweder zu toten oder zu verkaufen. Einige Tiere gelangten auf diese Weise in ein Therapieprogramm fur autistische Kinder. Die anderen wurden in den Iran verkauft. Dort verlor sich ihre Spur, was vermuten lie?, dass sie Gegenstand neuerlicher militarischer Experimente geworden waren.
Offenbar erlebten Meeressauger eine Renaissance in der strategischen Kriegsfuhrung. Wahrend des Kalten Krieges hatte ein regelrechtes Wettrusten zwischen den USA und der Sowjetunion stattgefunden, wer die effizienteste Meeressaugerstaffel aufbaute. Mit dem Ende der Blockstaaten schien sich Delphinspionage erledigt zu haben, doch dem Gerangel der Supermachte war keine bessere Weltordnung gefolgt. Der israelisch-palastinensische Konflikt geriet aus dem Ruder und begann die Region zu destabilisieren. Im Verborgenen wuchs eine neue, megapotente Generation von Terroristen heran, die in der Lage waren, amerikanische Kriegsschiffe zu sabotieren. Zahllose internationale Konflikte gipfelten in verminten Gewassern, verloren gegangenen Projektilen und wertvoller Ausrustung, die auf den Meeresgrund sank und wieder hochgeholt werden musste. Es zeigte sich, dass Delphine, Seelowen und Belugas jedem Taucher oder Roboter darin weit uberlegen waren. Beim Aufspuren von Minen arbeiteten Delphine nachweislich 12-mal effizienter als Menschen. Die US-Seelowen in den Militarbasen von Charleston und San Diego verbuchten im Aufspuren von Torpedos eine Erfolgsquote von 95 Prozent. Wahrend Menschen unter Wasser nur eingeschrankt arbeiten konnten, unter schlechter Orientierung litten und Stunden in Dekompressionskammern verbringen mussten, operierten die Sauger in ihrem naturlichen Lebensraum. Seelowen sahen noch bei extrem schlechten Lichtverhaltnissen. Delphine orientierten sich selbst in lichtloser Schwarze, indem sie Sonar einsetzten, ein Trommelfeuer von Klicklauten, aus deren Echos sie mit unglaublicher Prazision auf Standort und Form von Gegenstanden schlie?en konnten. Meeressauger tauchten muhelos Dutzende von Malen am Tag in Tiefen von mehreren hundert Metern. Ein kleines Team von Delphinen ersetzte Millionen teure Schiffe, Taucher, Besatzungen und Equipment. Und immer, fast immer, kamen die Tiere zuruck. In 30 Jahren hatte die US-Navy gerade mal sieben Delphine verloren.
Also wurden die amerikanischen Dressurprogramme mit neuen Mitteln fortgesetzt. Aus Russland horte man von ersten Anstrengungen, die Arbeit mit den Saugern wieder aufzunehmen. Auch die indische Armee begann mit eigenen Zucht— und Dressurprogrammen. Aktuell war selbst der Nahe Osten in die Forschung eingestiegen.
Hatte Vanderbilt am Ende Recht?
Anawak war uberzeugt, dass in den Tiefen des Web Informationen zu finden waren, die man auf der Homepage der US-Navy vergebens suchte. Er horte nicht zum ersten Mal von Militarversuchen, um Wale und Delphine vollstandiger Kontrolle zu unterwerfen. Dabei ging es weniger um klassische Dressur als um neuronale Forschung, wie sie John Lilly einst begonnen hatte. Weltweit hegte das Militar ein ausgepragtes Interesse am Sonar der Delphine, das jedem menschlichen System uberlegen war und dessen Funktionsweise man immer noch nicht verstand. Vieles deutete darauf hin, dass in jungster Vergangenheit Experimente stattgefunden hatten, die weit uber alles hinausgingen, was man offiziell bereit war einzugestehen.